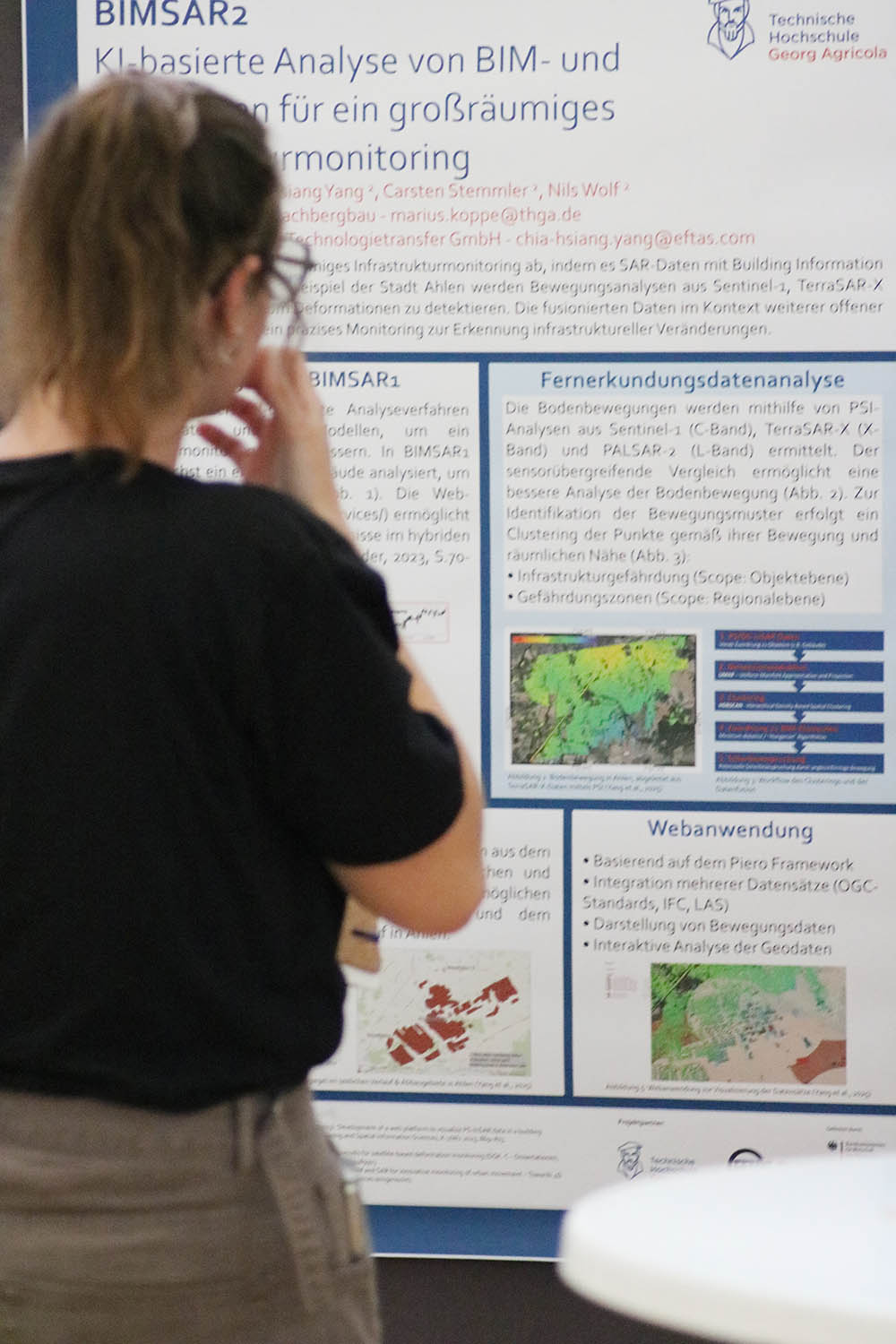Die EU-Methanverordnung ist Teil der Bemühungen der Europäischen Union, die Methanemissionen zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen, denn Methan wird nicht nur durch viele Industrien und Wirtschaftszweige emittiert, sondern wirkt auch als starkes Treibhausgas. Nach fast genau einem Jahr nach dem Inkrafttreten der Verordnung wurde am 3. Juli im Studierendenzentrum der THGA in einer gemeinsamen Fachveranstaltung vom FZN und der Bezirksgruppe Ruhr der DGMK e.V. genauer nachgeschaut: Wie ist der Stand? Welche Schlüsse lassen sich nach einem Jahr ziehen und was sind die Auswirkungen auf Industrie und Forschung?
Die als Fachdialog konzipierte Veranstaltung „Ein Jahr EU-Methanverordnung – Quo vadis!?!“ ermöglichte gleichermaßen den Austausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Behörden – und bot dabei Raum zur Vernetzung und die thematische Einbindung von Herausforderungen und Möglichkeiten für eine nachhaltige Energiepolitik und den nachhaltigen Umgang mit Georessourcen.
Veranstaltungskoordinator, FZN-Wissenschaftler und Vorsitzender der DGMK-Bezirksgruppe Ruhr, Prof. Dr. Tobias Rudolph, ermöglichte hierzu zusammen mit der DGMK-Geschäftsführerin Dr. Gesa Netzeband und Ines Musekamp (DGMK-Koordinatorin des Fachbereichs Geo-Energiesysteme und Untertagetechnologien) eine multidisziplinäre Betrachtung (z.B. rechtliche Rahmenbedingungen, unternehmerische Perspektiven und technologische Möglichkeiten zur Methandetektion) der Thematik.
Ein multiperspektivischer Blick auf die Methanverordnung
Den Anfang machte Brian Ricketts, Generalsekretär von EURACOAL. Aus Brüssel angereist, beleuchtet der Experte anschaulich die aktuelle rechtliche Lage und ordnet die regulatorischen Rahmenbedingungen ein. Mit seinem länderübergreifenden, europäischen Blick und seinen umfassenden Kenntnissen der politischen Landschaft konnte Brian Ricketts nicht nur den Zeitstrahl zur Implementierung der EU-Methanverordnung, sondern auch nationale Besonderheiten vermitteln. Dieses zeigte er am Beispiel Polen auf, welches besonders im Bergbaukontext von der Verordnung betroffenen ist. Er präsentierte weiterhin neben dem Anteil natürlicher Methanemissionen auch die menschengemachten Anteile zur Freisetzung von Methan in der EU. Dabei führte der EURACOAL-Generalsekretär auch die Anteile von Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Abfallwirtschaft als maßgebliche Gründe für den anthropogenen Ausstoß des Treibhausgases auf.
Als ausgewiesener Experte der Kohlewirtschaft sowie der EU-Politik gelang es Brian Ricketts den Teilnehmer:innen Klarheit über die Umsetzung der Methanverordnung in der EU zu vermitteln. Dieser europäische Blick und der informative Vortrag boten die Basis für die beiden folgenden Referenten, die einen eher technischen bzw. praxisorientierten Schwerpunkt in ihren Präsentationen hatten.
Sebastian Spürk von der DMT Group stellt so folgend detailliert technische Entwicklungen im Kontext von Methanmanagement vor und zeigt auf, wie sich Unternehmen auf neue Anforderungen einstellen. Hierzu präsentierte er wie viel Erfahrung aber auch welch ein komplexes Zusammenspiel von Wissen in Geologie, Hydrologie, Chemie, Ingenieurswissenschaften und Physik benötigt wird, um zu einem bestmöglichen Methanmanagement zu gelangen. Konkret zeigte er hierzu wie die DMT Group Methanmanagment unter und über Tage umsetzt – und wie essentiell hierzu breitflächige Detektion bzw. Datenerhebung ist.

Hightech im Geomonitoring als Mittel zur Methandetektion
Dieser eher unternehmerische und praxisorientierte Ansatz von Sebastian Spürk aus Sicht der DMT Group schuf einen fließenden Übergang zu Dr. Benjamin Haske vom FZN. Er erläuterte in seiner folgenden Präsentation Möglichkeiten der Methandetektion und stellte aktuelle Forschungsansätze und praktische Anwendungen vor. Dr. Benjamin Haske vermittelt den Teilnehmer:innen, wie engmaschige und umfassende Methandetektion gelingen kann. Dazu schilderte er anschaulich von fern zu nah – von satellitengestütztem Monitoring zu Drohnenmonitoring – was moderne Technik und Software leisten kann.
Ein Augenmerk in seinem Vortrag lag bei der indirekten Detektion von Methan, wie sie über das Ermitteln von der Pflanzengesundheit im Untersuchungsraum mittels Drohnen erfolgen kann. Auch stellte er vor, wie man das kostengünstige wie effektive Monitoring mit Drohnen in verschiedenen Flughöhen – und somit verschiedenen Auflösungen praktisch bewerkstelligen kann.
Doch auch das ungewollte Austreten von Methan aus Gastanks kann dank des Joule-Thomson-Effekt komfortabel detektiert werden, schilderte Dr. Benjamin Haske. Der Joule-Thomson-Effekt beschreibt, wie Gas beim Verdampfen zu einer Abkühlung der Umgebung sorgt. Folgerichtig lässt sich mittels Infrarotkameras frühzeitig die Abkühlung der Temperatur und somit das ungewollte Entweichen von Methan aus Tanks feststellen.
Fachdiskussion unterstreicht die Relevanz der EU-Methanverordnung
In diesen drei Präsentationen und den Rückfragen vom Publikum wurde deutlich: Die Thematik in und um Methan ist hochaktuell und äußerst komplex – berührt sie doch unzählige Industriezweige und unterschiedliche Rahmenbedingungen in den europäischen Nationen in Bezug auf Wirtschaft, Industrie, Geologie sowie Formen des Bergbaus.
Während das brennbare Gas auch einen Stellenwert in der Energieerzeugung hat, richten sich viele Medien bei der Thematisierung von Methanemission auf die Landwirtschaft, obgleich die Verordnung auch unmittelbare Auswirkungen auf den Bergbau bzw. Nachbergbau, Öl- und Gasindustrie sowie die Energiewirtschaft hat. Obgleich die Landwirtschaft den höchsten Anteil am anthropogenen Ausstoß von Methan hat, ist dessen Emission auch unmittelbar mit dem Bergbau verbunden.
So wird Methan innerhalb des aktiven Steinkohlebergbaus freigesetzt; stillgelegte Bergwerke können teils noch über lange Zeiträume erhebliche Mengen Methan freisetzen. Angesichts dieser Relevanz im gesamteuropäischen Kontext als auch im Bergbaukontext bzw. Nachbergbaukontext wird das FZN auch weiterhin den Fokus auf diese Thematik setzen und im engen länderüberschreitenden Austausch bleiben.
Wir danken allen Teilnehmer:innen für die Teilnahme und den Austausch!
Kontakt

Prof. Dr. rer. nat. Tobias Rudolph
Forschungszentrum Nachbergbau
Herner Straße 45
44787 Bochum
Gebäude 2, Raum 101
Telefon 0234 968 3682
Mail tobias.rudolph@thga.de